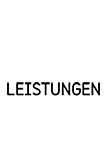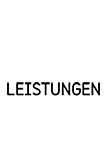Fotos © Eva Wahl
|
INTERVIEW Wiener Zeitung, Printausgabe 24. August 2013
»Eine lebendige Streitkultur ist unerlässlich«
Christine Dobretsberger im Gespräch mit Josef Haslinger
Der Schriftsteller Josef Haslinger erläutert seine Aufgaben als neuer Präsident des PEN-Zentrums Deutschland, denkt darüber nach, wie man das Schreiben unterrichten kann, und berichtet von der zeithistorischen Arbeit an seinem Roman "Jachymov", der in Tschechien spielt.
"Wiener Zeitung": Herr Haslinger, Sie sind seit Mai Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Als eines Ihrer primären Ziele haben Sie Ihr Ansinnen geäußert, dass Intellektuelle in der Öffentlichkeit wieder mehr mitmischen sollten.
Josef Haslinger: Der PEN ist als menschenrechtspolitisches Instrument 1921 gegründet worden, mit der Zielsetzung sich einzumischen, und zwar international. Der PEN ist von seiner Satzung her nicht ein Autorenverein, der sich um das Schöngeistige kümmert, sondern er tritt für ein friedliches Zusammenleben der Völker ein und dafür, dass keiner aufgrund seiner Rasse diskriminiert wird oder aufgrund seiner Gedanken, Aussagen und Schriften verfolgt wird. Dieses liberale Denken hat in der Aufklärung seine Wurzeln, war im 20. Jahrhundert auf allen Breiten gefährdet und ist letztlich auch europaweit verloren gegangen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist der PEN gegründet worden. Mittlerweile gibt es 140 nationale Zentren in aller Welt. Europa steht jetzt weniger im Fokus des Engagements des internationalen PEN, aber hin und wieder kommt es auch zu europäischen Resolutionen.
Welche europäische Resolution wurde zuletzt verabschiedet?
Eine zu Ungarn. Sie wurde während der Jahrestagung in Marburg verabschiedet und wir werden sie im September auch in den internationalen PEN hineintragen. Anlass sind antisemitische und antiziganistische Tendenzen, die sich in Ungarn breit machen. Zuletzt wurde dem ungarischen Autor György Konrád nachgesagt, er sei kein echter Ungar - wegen seiner jüdischen Herkunft. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns da einmischen, dass wir nicht zulassen, dass ein Land, das der europäischen Gemeinschaft angehört, nationalistische oder rassistische Sonderwege geht. Ich glaube, dass die Intellektuellen in aller Welt, und da gibt es keine Grenzen, schon gar nicht nationale, sich als eine große Community verstehen sollten, deren Aufgabe es nicht ist, einer Meinung zu sein, sondern an der Entwicklung der Welt zu arbeiten. Das ist keine Verpflichtung, sondern ein gemeinsames Bekenntnis derer, die sich im PEN zusammengeschlossen haben.
Wie kam es dazu, dass dem PEN in den letzten Jahren relativ wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde, wenn man es mit früher vergleicht?
Was den deutschen PEN betrifft, gab es tatsächlich ein Problem, das den Schriftstellerverband in seiner Schlagkraft jahrelang blockiert hat: Das war die Wiedervereinigung, die auf der Seite der Schriftsteller länger gedauert hat als im Land selbst. Diese Debatten sind nun beigelegt und ich bin somit der erste Präsident, der von dieser Problematik nicht berührt ist. Jetzt können wir neu durchatmen.
Sie ließen auch durchblicken, dass Sie den PEN speziell für junge Autoren attraktiver machen möchten. Welche Pläne verfolgen Sie diesbezüglich?
Es ist mein Ziel, den Zugang für junge Autoren zu erleichtern, wenngleich das nur in einer Jahresversammlung entschieden werden kann. Um dem deutschen PEN beitreten zu dürfen, muss man derzeit mindestens zwei Bücher veröffentlicht haben und von zwei Mitgliedern vorgeschlagen werden. Ich denke, dass man diese restriktive Aufnahmepolitik durchaus in Frage stellen kann. In England oder Amerika gelten beispielsweise andere Aufnahmekriterien.
Welche Vorteile hat man, wenn man Mitglied beim PEN ist?
Man hat den Kontakt zu jeder Menge bedeutender Kollegen und die Möglichkeit eines gemeinsamen Engagements. Auch wenn es nicht immer wahrgenommen wurde, hat der PEN in den letzten Jahren wichtige Arbeit geleistet.
Zum Beispiel?
Zum einen durch das Writers-in-Exile Programm. Deutschland hat, international betrachtet, das profilierteste Programm dieser Art in Europa. Es werden Autoren eingeladen, die in ihren Heimatländern verfolgt sind oder deren Schriften und Bücher verboten wurden. Diese Autoren können in Deutschland auf der Basis eines Stipendiums für ein bis drei Jahre Schutz finden. Daneben gibt es das Writers-in-Prison-Programm. Dessen Tätigkeit besteht darin, immer wieder auf das Schicksal inhaftierter Autoren aufmerksam zu machen und ihnen entweder in einer rapid action mit Interventionen aller Art zu Hilfe zu eilen oder ihnen eine internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen. So wird den Heimatländern signalisiert: was ihr hier macht, bleibt nicht unbemerkt. Der weißrussischen Journalistin Iryna Khalip wurde für ihr demokratisches Engagement letztes Jahr vom deutschen PEN der Hermann-Kesten-Preis verliehen. Sie stand damals unter Hausarrest und konnte nicht persönlich zu Preisverleihung kommen. Vor wenigen Tagen wurde ihre Strafe von einem weißrussischen Gericht aufgehoben. Oft sind es ja Namen von Individuen, die dem Widerstand Sprengkraft verleihen. Was man davon hat, Mitglied des PEN zu sein? Letztlich hat man nichts davon, aber man kann hoffen, dass andere etwas davon haben. Das gute Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben, ist ja bekanntlich auch nicht zu verachten.
Dass Intellektuelle wieder mehr zu Wort kommen sollten, ist Ihnen ja nicht nur als PEN-Präsident ein Anliegen, sondern auch ein persönlicher Wunsch.
In einer Zeit, in der die öffentlichen Werte keine Selbstverständlichkeit sind, steht es Intellektuellen gut an, sich einzumischen. Es gibt ja keine Wertegrundsicherung, kein klares Fundament, in dem alles verankert ist. Es gibt keinen Kodex, der endgültig ist, kein Gesetz, das durch unumstößliche Kaiser- oder Gottesmacht gesichert wäre. Die Werte sind so lange gesichert, wie die Menschen dafür einstehen. In dem Augenblick, in dem sie es nicht mehr tun, kippt die Sache. Wenn irgendwo eine rassistische Partei Stimmung macht und Anklang findet, ändert sich das Wertebild dieser Gesellschaft. Feindbilder können schnell attraktiv werden. Davor ist keine Gesellschaft gefeit. Es muss Menschen geben, die versuchen, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Eine lebendige Streitkultur ist unerlässlich für eine offene Gesellschaft Das Feld der Meinungsbildung darf nicht den Geschäftemachern allein überlassen werden.
weiterlesen: Wiener Zeitung
|