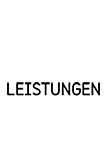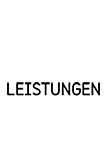Fotos © Robert Wimmer
|
INTERVIEW Wiener Zeitung, Printausgabe 24. September 2011
»Dem Leser kann man alles zumuten«
Paulus Hochgatterer im Gespräch mit Christine Dobretsberger
Der Schriftsteller und Kinderpsychiater Paulus Hochgatterer über den entscheidenden Umgang mit Sprache in seinen beiden Fachgebieten, über den konstruktiven Umgang mit Aggressionen - und darüber, wie die Realität die Fiktion übertrifft.
"Wiener Zeitung": Nach Ansicht von Marcel Reich-Ranicki sind sowohl Literaten als auch Mediziner Fachleute für das menschliche Elend. Demzufolge sei es nahe liegend, dass es zwischen diesen beiden Berufsgruppen erstaunlich viele Berührungspunkte gibt. Welches Interesse war bei Ihnen zuerst da: jenes für die Literatur oder jenes für die Medizin?
Paulus Hochgatterer: Eindeutig jenes für die Literatur. In der Selbsterforschung, die man als Kinderpsychiater natürlich gern in die eigene Kindheit hinein betreibt, stößt man in Hinblick auf die Literatur klarerweise zuallererst auf die eigene Lektüreerfahrung und auf die Geschichten, die einem von den Eltern vorgelesen wurden. Gleichzeitig spielte in unserer Familie das Erzählen der eigenen Geschichten eine große Rolle. Das war in meiner Kindheit etwas, das ich in der Erinnerung sehr mit Lust verbinde. Die Geschichten aus dem Leben meiner Eltern erzählt zu bekommen, war mindestens ebenso wertvoll, wie wenn ich Märchen aus Grimms Märchenbüchern vorgelesen bekam.
Ist diese Lust an realen Geschichten auch mit Ihrem Schreiben verbunden?
Es ist insofern mit meinem Schreiben verbunden, als ich - wie jeder, der schreibt- auch über mich selbst schreibe und dies nicht als unlauter empfinde, sondern als etwas, das Wert hat.
Als Leser hat man schon allein deswegen eine Nähe zu Ihnen als Autor, weil die Protagonisten in Ihren Büchern oft Psychiater sind.
Zu Recht! Mit Psychiatern kenne ich mich einigermaßen aus. Warum sollte ich also nicht über Psychiater schreiben?
Lesen Ihre Ärzte-Kollegen Ihre Bücher?
Ja, inzwischen geben sie es auch zu. Und mein Eindruck ist, dass sie den meisten gefallen.
Die Kollegenschaft bzw. der Spitalsbetrieb kommt in Ihren Romanen ja nicht immer gut weg.
Die Medizin hält das schon aus, und die Psychiatrie hält das, glaube ich, erst recht aus, wenn man sich ein bisschen lustig macht über sie.
Inwiefern unterscheidet sich der diagnostische Blick beim Schreiben von jenem in Ihrer Arbeit als Kinderpsychiater?
So unterschiedlich ist das gar nicht. Sowohl beim Schreiben als auch in der Psychiatrie kommt es sehr auf phänomenologische Dinge an. Es dreht sich somit um die Frage: Wie stellen sich Menschen oder Dinge dar? Was sieht man an der Oberfläche? Das ist für beide Bereiche wichtig. Und das wirklich Entscheidende sind dann jene Dinge, die zwischen den Zeilen oder zwischen den Worten stehen.
weiterlesen: Wiener Zeitung
|